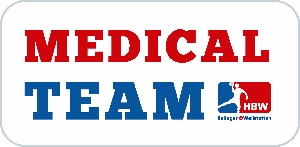Der Weg zur richtigen Prothese
Ablauf der Prothesenversorgung
 Direkt nach der Amputation ist der Stumpf in der Regel geschwollen und kann noch nicht voll belastet werden. Die Operationswunde ist zudem noch nicht verheilt. Bevor mit der Prothesenversorgung begonnen werden kann, muss der Stumpf zunächst vorbereitet werden und die Wunde abheilen.
Direkt nach der Amputation ist der Stumpf in der Regel geschwollen und kann noch nicht voll belastet werden. Die Operationswunde ist zudem noch nicht verheilt. Bevor mit der Prothesenversorgung begonnen werden kann, muss der Stumpf zunächst vorbereitet werden und die Wunde abheilen.
Bereits im Krankenhaus wird damit begonnen, den Stumpf mit Kompressionsbandagen zu umwickeln oder sogenannte Post-OP-Liner zu verwenden, um dem entstandenen Ödem entgegenzuwirken. Diese Kompressionsbehandlung, bei der im weiteren Verlauf auf spezielle Stumpfstrümpfe gewechselt wird, wird auch in der stationären Rehabilitation fortgesetzt. Außerdem wird der Stumpf vorsichtig »abgehärtet«, d. h. auf die neue Belastungssituation in der Prothese vorbereitet. (Bild: © by Össur)
Da sich der Stumpf in der Anfangsphase nach der Operation noch verändert, würde eine zu frühe Prothesenversorgung dazu führen, dass der Schaft permanent neu angepasst werden müsste. Ist die Wundheilung abgeschlossen, wird daher zunächst eine Interimsprothese angefertigt, die der Frühmobilisation und der weiteren Reduzierung des Stumpfödems dient. Da frisch Amputierte ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben, müssen die Passteile dieser ersten Prothese sorgfältig ausgewählt werden.
Wenn der Stumpf seine Form und Festigkeit gefunden hat, was ungefähr nach drei bis sechs Monaten der Fall ist, wird mit der Anpassung einer sogenannten Definitivprothese begonnen. Diese Prothese zeichnet sich durch eine individuelle Passform sowie einen sorgfältigen statischen und dynamischen Aufbau aus. Bevor eine dem Patienten angepasste Prothese jedoch ihre definitive Gestalt erhält, wird nach der Maßabnahme zunächst eine Prothese für den Zustand der Anprobe gebaut, um gegebenenfalls kleinere Änderungen und Nachpassarbeiten durchführen zu können.
Auswahl der richtigen Prothese – die Sache mit den Mobilitätsgraden
Heutzutage stehen für die Versorgung von Beinamputierten eine Vielzahl unterschiedlicher Schaftformen, Schafttechniken und Passteile zur Verfügung. Das macht es einerseits leichter, für jeden Betroffenen die richtige Prothese anzufertigen, andererseits aber auch wieder schwerer, aus dem großen Angebot das jeweils richtige Passteil auszuwählen.
Grundsätzlich gilt: Die beste Prothese gibt es nicht. Was dem einen ausreichend Sicherheit verschafft, behindert den anderen Prothesenträger in seiner Mobilität. Auch ist es nicht immer das technisch ausgereifteste und neueste Teil, das die optimale Versorgung gewährleistet.
Um dem verordnenden Arzt und dem Orthopädietechniker, der für den Bau der Prothese zuständig ist, eine Orientierung für die Auswahl und Zusammenstellung der richtigen Prothese an die Hand zu geben, wurden fünf sogenannte Mobilitätsgrade entwickelt, in die jeder Amputierte mit Hilfe eines Profilerhebungsbogens eingruppiert wird.
Mit dem Profilerhebungsbogen werden beispielsweise neben der Krankengeschichte Fragen zum aktuellen Gesundheitszustand, zu den derzeitigen und zu erwartenden Fähigkeiten sowie zum sozialen Umfeld des Patienten gestellt. Dazu gehört unter anderem, ob der Patient in der Lage ist, alleine öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, Alltagshindernisse zu überwinden, eine Familie zu versorgen oder ob er einem Beruf nachgeht.
Die Mobilitätsgrade beschreiben das Therapieziel unter Berücksichtigung der aktuellen und der zu erwartenden Fähigkeiten des Patienten. Da sich diese im Lauf der Zeit verändern können, ist die Eingruppierung nicht für immer festgeschrieben, sondern sollte regelmäßig überprüft werden. Die Mobilitätsgrade dienen als Orientierung für die Prothesenauswahl. Im Mittelpunkt muss aber immer der jeweilige Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen stehen.
Textquelle: Auzug aus: Patientenratgeber »Beinamputation – Wie geht es weiter?« der eurocom e.V.