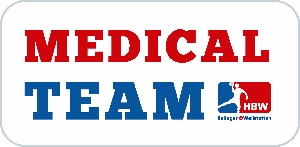Kinderorthopädie
Häufig gestellte Fragen
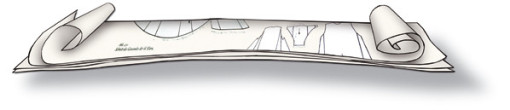
Welche Kinder erhalten therapeutische Frühförderung?
Der Arzt muss die Behandlung verschreiben. Die Behandlung wird je nach ärztlicher Verordnung sowohl im häuslichen Bereich, als auch in den Einrichtungen der Spastikerhilfe durchgeführt.
Die Zielgruppe besteht aus Kindern, die eine verlangsamte oder auffällige sensomotorische Entwicklung vorweisen, neurologisch oder neuromuskulär erkrankt sind oder Störungen in der Wahrnehmungsverarbeitung haben.
Welche Ziele werden bei der Behandlung verfolgt?
Das Ziel der therapeutischen Frühförderung ist, dem Kind möglichst frühzeitig alle Voraussetzungen für die motorische und sensorische Entwicklung zu vermitteln, damit es eine für sich optimale Entwicklung durchlaufen kann.
Wird in der Behandlung jedes Problem »geheilt«?
Nein, im Vordergrund steht das Kind mit seinen Fähigkeiten und Schwierigkeiten in jedem Entwicklungsbereich (Motorik, Sensorik, Kognition, Sprache, Spiel und soziales Verhalten). Unter Berücksichtigung des Krankheitsbildes und in Anlehnung an die kindliche Entwicklung werden den Kindern in der Einzelsituation neue Möglichkeiten gezeigt, sich zu bewegen, zu begreifen und zu erproben. Diese neu erlernten Fähigkeiten werden in der Therapie so lange gefestigt, dass sie auch auf Alltagssituationen übertragen und somit selbstverständlich ausgeführt werden können.
Unser Tipp
Den Alltag leichter machen ...
Wir sind den Kindern, Jugendlichen und Eltern ein Partner und Begleiter auf den sie sich verlassen können. Wir liefern und empfehlen ausschließlich Produkte, von deren Nutzen und Qualität wir uns immer wieder überzeugt haben.
Wir sorgen dafür, dass Informationen, Wissen und Erfahrung gezielt und umfassend an alle Beteiligten weitergegeben werden.
Wofür braucht ein Kind Hilfsmittel?
Die Hilfsmittel sollten dem Kind ermöglichen so selbstständig wie möglich zu werden in den Bereichen:
- Mobilität (z. B. Rollstuhl, Orthesen, Autositz);
- Alltagshilfen (z. B. angepasstes Besteck, Greifarm);
- Kommunikation (z. B. Talker, Mundspange) und
- Pflege (z. B. Betten, Duschstuhl).
Wie sollten Sie vorgehen, wenn Ihr Kind ein neues Hilfsmittel braucht?
 Wenn Ihr Kind ein neues Hilfsmittel braucht, ist eine Verordnung vom Arzt notwendig. Es ist aber gut, sich vorher zu orientieren welche Möglichkeiten es gibt. Die Medizinprodukteberater der reha teams verfügen über viel Erfahrung in der Hilfsmittelversorgung und haben auch die Möglichkeit zusätzliche Fachinformationen zu beschaffen. Es besteht oft die Möglichkeit ein Hilfsmittel auszuprobieren, um auf diesem Weg zur bestmöglichen Lösung zu kommen.
Wenn Ihr Kind ein neues Hilfsmittel braucht, ist eine Verordnung vom Arzt notwendig. Es ist aber gut, sich vorher zu orientieren welche Möglichkeiten es gibt. Die Medizinprodukteberater der reha teams verfügen über viel Erfahrung in der Hilfsmittelversorgung und haben auch die Möglichkeit zusätzliche Fachinformationen zu beschaffen. Es besteht oft die Möglichkeit ein Hilfsmittel auszuprobieren, um auf diesem Weg zur bestmöglichen Lösung zu kommen.
Wenn die Entscheidung über das Hilfsmittel getroffen ist, ergeht seitens von uns ein Kostenvoranschlag an die Krankenkasse. Nach Genehmigung erfolgt die Auslieferung nach Terminabsprache direkt über uns. Wir kontrollieren in der nachgehenden Betreuung regelmäßig die richtige Einstellung, Passform und Handhabung der bereit gestellten Hilfen.
Wie findet der Austausch mit den Eltern, Therapeuten und behandelnden Ärzten statt?
Mit der Genehmigung der Eltern sprechen wir mit den Therapeuten/-innen und dem behandelnden Arzt, um Diagnose, Fortschritte und Therapieschwerpunkte des Kindes zu klären und Versorgungswege darzustellen.
Was ist Handlungsfähigkeit?
Handlungsfähigkeit ist die Verknüpfung motorischer, psychisch-emotionaler und geistig-kognitiver Fähigkeiten. Voraussetzung dafür ist eine gute Wahrnehmungsverarbeitung (sensorische Integration). Dem Kind werden u. a. durch Reize Erfahrungen nahegebracht, die es selbstständig nicht machen kann, weil es z. B. motorisch dazu nicht in der Lage ist.
Was ist mit Kommunikation gemeint?
Kommunikation ist der Austausch von Botschaften zwischen zwei oder mehreren Personen. Alles, was eine Person macht, kann eine Botschaft überbringen, vorausgesetzt, dass es einen Empfänger für die Botschaft gibt, der darauf reagiert.
Kommunikation kann mit oder ohne Symbole und durch Sprache stattfinden.
Ohne Symbole:
- Hinlangen nach etwas (z. B.: reichen nach der Jacke, die zu hoch hängt);
- Haltung (z. B.: das Kind fühlt sich stark und macht sich groß);
- Gesichtsausdruck (z. B.: froher Gesichtsausdruck);
- Körpersprache (z. B.: erröten, schwitzen);
- Intonation/Melodie (z. B.: höhere Stimme bei Aufregung);
- Stimmvolumen (z. B.: lauter sprechen, wenn man böse ist);
- Zeigen (z. B.: zeigen mit dem Finger auf das Gewünschte);
- Schreien, lachen, rülpsen, gähnen, usw. (z. B. die Mutter lacht, das Kind lacht zurück).
Mit Symbolen:
- Gebärden, Bilder, Einwortsätze;
- Wörter, Gebärden, Bilder in Zweiwortsätzen ohne grammatikalische Struktur (Symbolsysteme).
Durch Sprache:
- Gesprochene Sprache;
- Geschriebene Sprache;
- Gebärdensprache.